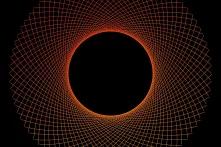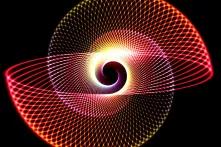Verdrängung, Überwachung, Bettelverbote, rassistische Polizeikontrollen - allzu oft geht es um die Stadt als gefährlichen Ort, der kontrolliert und diszipliniert werden muss. Neoliberale Logiken wollen die Stadt vermarkten. Damit sind zwei Grundpfeiler staatlicher Politiken städtischen Raumes markiert: Sicherheit und Konsum. Dabei ginge es um einen Raum, an dem alle teilhaben können.

Dieser Beitrag ist Teil unseres Dossiers "Politik im autoritären Sog". Sie können das vollständige Dossier hier als PDF herunterladen.
Autoritäre Politiken im städtischen öffentlichen Raum
Inhalt
- Der städtische öffentliche Raum
- Die Stadt als Marke
- Armut bekämpfen oder arme Menschen verdrängen?
- Videoüberwachung statt sichere Radwege
- Racial Profiling statt weibliche Teilhabe
- Autoritäre Sicherheitsdiskurse und neoliberaler Ausverkauf
- Bürger*innen als Akteur*innen, als Gesprächspartner*innen oder als Gefahr?
- Bürgerkriegsspiele statt politische Auseinandersetzungen
- Öffentlicher Raum als Staatsaufgabe – Öffentlichkeit als Raum der Zivilgesellschaft
Im Juli 2018 wurde in Berlin ein Brandanschlag auf zwei wohnungslose Männer verübt.[1] Eines der Opfer lag noch im Koma, als die Polizei zehn Tage später einen Tatverdächtigen präsentierte und vor allem verkündete, dem Anschlag habe kein „obdachlosenfeindliches Motiv“ zugrunde gelegen, sondern der Tatverdächtige habe mit den beiden wohnungslosen Männern Streit gehabt.[2] Nach diesem Streit, der mit einem Platzverweis für ihn endete, hatte er an einer nahe gelegenen Tankstelle Benzin gekauft und die beiden Männer, die unter der Brücke eines S-Bahnhofs schliefen, damit übergossen und angezündet.
Der Anschlag hatte ein erhebliches mediales Echo hervorgerufen. Dabei wurde zum einen Entsetzen über die Grausamkeit und Feigheit der Tat geäußert, teils aber auch das grundlegende Problem mangelnden Wohnraums und der Gewalt gegen wohnungslose Personen wieder ins öffentliche Bewusstsein gerufen. Am Tatort wurden Mahnwachen abgehalten und es gab einen Moment des Innehaltens, des Nachdenkens darüber, was Sicherheit in einer Großstadt wie Berlin für Menschen bedeuten kann, die keine Wohnung, keine soziale Absicherung und keine Interessenvertretung haben und im öffentlichen Straßenraum leben.
Die medienwirksame Feststellung, dass der Brandanschlag nicht aus „obdachlosenfeindlichen Motiven“ erfolgte, hat der Tat die politische Dimension genommen, sie zu einem Streit am Rande der Gesellschaft gemacht. Ein solcher Streit zieht aber nicht notwendig einen Mordversuch nach sich. Die spezifische Verletzbarkeit wohnungsloser Menschen, über die nun nicht mehr geredet werden musste, spielte eine wesentliche Rolle. Vor allem aber war es nicht fernliegend, dass andere Wohnungslose, Sozialarbeiter*innen und Nachbar*innen zunächst von einem anderen Tatmotiv ausgingen, nämlich menschenverachtendem Hass auf wohnungslose Personen.
Von 1989 bis 2017 sind 240 Obdachlose in Deutschland durch nicht-wohnungslose Angreifer getötet worden, rund 850 wurden schwer verletzt.[3] Es war auch nicht das erste Mal, dass auf wohnungslose Personen ein Brandanschlag verübt wurde. Teils werden Aggressionen an den Schwächsten der Gesellschaft ausagiert, teils fühlen sich die Täter aber auch dadurch gerechtfertigt, ein diffuses öffentliches Sicherheits- und Ordnungsbedürfnis zu vollstrecken. Sicherheit ist das zentrale Schlagwort in vielen Debatten um städtischen öffentlichen Raum. Allerdings bedeutet Sicherheit für wohnungslose Personen etwas ganz Anderes als für den Gewerbeverein, der einige Einkaufsstraßen attraktiver machen möchte, und für Radfahrer*innen etwas Anderes als für Innensenatoren, die sich für flächendeckende Videoüberwachung einsetzen.
Gewalt gegen wohnungslose Personen gründet nicht zuletzt auf Vorstellungen von einer sauberen Stadt, in der Armut nicht sichtbar ist, alle einer geregelten Arbeit nachgehen und der öffentliche Raum nur für Fortbewegung, Konsum, Flanieren und ggf. politischen Austausch genutzt wird. Gerade Berlin blickt auf eine sehr lange Tradition massiver staatlicher Gewalt im öffentlichen Raum zurück, mit der Gefährdungen, Aufruhr, Armutsunruhen oder politische Auseinandersetzungen vermieden werden sollten, und die vor allem Gegengewalt nach sich zog.[4] Soziale Politiken als Alternative zu Sicherheitspolitiken sind wenig werbewirksam, langwierig und mühsam und widersprechen neoliberalen Marktlogiken.
Dabei sind die Leitbilder von Sicherheit und Markt im Stadtraum eng verwoben und bedingen sich gegenseitig. Die Stadt wird zur Marke, der städtische Raum selbst zum Konsum freigegeben, städtische Politiken gehen in unentrinnbare Privatisierungsschleifen, soziale Politiken und soziale Stadtgestaltung scheitern an der Finanzierungsfrage. Die am Ende auf die reine Staatsgewalt reduzierte Obrigkeit nutzt städtische Räume immer wieder auch als Erprobungsfeld für neue Methoden und Strategien der inneren Sicherheit. (↑ nach oben)
Der städtische öffentliche Raum
Der städtische öffentliche Raum ist ein Mythos, aber auch Lebensrealität für sehr viele Menschen. Weltweit nimmt die Zahl der Menschen, die in urbanen Räumen und Metropolen leben, stetig zu. Die Stadt verspricht insbesondere Freiheit von sozialer Kontrolle, die Illusion der Neuerfindung, bessere Möglichkeiten des Broterwerbs und politischen Aktionsraum. Für viele Menschen ist der städtische Raum auch Lebensraum, denn auch in deutschen Städten findet zumindest im Sommerhalbjahr Leben zunehmend auf der Straße, auf Plätzen und in öffentlichen Grünanlagen statt. Öffentlicher städtischer Raum ist aber eine knappe Ressource, um deren Nutzung hart konkurriert wird. Die Verknappung erfolgt durch verschiedene Formen der Privatisierung, aber auch durch vermehrte und plurale Nutzungen des Staates, der Wirtschaft, der Einwohner*innen.
Städtischer Raum wird seit langem als staatliche Regelungsaufgabe wahrgenommen, wobei der Fokus häufig weniger darauf liegt, wie plurale Nutzungen ermöglicht werden und ein Raum entsteht, an dem viele teilhaben können. Vielmehr geht es allzu oft um die Stadt als gefährlichen Ort, der kontrolliert und diszipliniert werden muss. Neoliberale Logiken haben aus der Stadt zudem eine Marke gemacht, die in Konkurrenz zu anderen (städtischen) Räumen steht, die vermarktet und deren Attraktivität erhalten werden muss. Dies führt zur staatlichen Durchsetzung nicht nur autoritärer Ordnungsvorstellungen, sondern auch neoliberaler Verwertungslogiken.
Damit sind zwei Grundpfeiler staatlicher Politiken städtischen Raumes markiert: Sicherheit und Konsum. Diese bedingen sich teils, teils stehen sie nebeneinander, und beide führen je für sich und gemeinsam zum Ausschluss bestimmter Gruppen von diskriminierungsfreier Teilhabe an städtischen öffentlichen Räumen. (↑ nach oben)
Die Stadt als Marke – Vermarktung städtischen Raumes
Städte werden von Stadtverwaltungen zunehmend als Unternehmen geführt, die in Konkurrenz zu anderen Städten stehen, Gewinn generieren und die Stadt als verwertbare Marke präsentieren müssen. Die Stadt als Marke verkennt jedoch die Bedeutung städtischen öffentlichen Raumes als Lebensraum, als politischen Raum, als zivilgesellschaftlich gestaltbaren Raum, als Allmende oder Commons völlig[5] und sieht ihn wie andere öffentliche Eigentümer lediglich als etwas, aus dem das Maximum herausgeholt werden sollte, bevor man es ruiniert hat und wegwirft. Zu den wesentlichen Formen der Vermarktung und Verwertung städtischen Raumes gehören Privatisierung, Tourismus und Eventisierung.
Wie andere öffentliche Ressourcen wird auch der städtische Raum von der öffentlichen Hand nicht selten als verfügbare Ressource angesehen, die auch durch Privatisierung verwertet werden darf. Wer sich verfassungsrechtlich hiermit beschäftigt, wird erfahren, dass es quasi keine Grenzen für die (oft endgültige) Verfügung über existentielle Gemeingüter wie den öffentlichen Raum gibt. In vielen deutschen Städten sind allgemein zugängliche Straßen und Plätze längst in Privatbesitz und öffentliche Räume werden von privaten Sicherheitsdiensten kontrolliert oder von wirtschaftlichen Akteur*innen hemmungslos zur eigenen Gewinnmaximierung genutzt, ohne dass eine formale Privatisierung vorliegen würde.
Ein sehr augenfälliges Beispiel ist der alte Wasserturm im Hamburger Schanzenpark, welcher zunächst unter der Bedingung privatisiert wurde, dass neben einem Hotelbetrieb auch Räume für die Nutzung durch die städtische Zivilgesellschaft vorgehalten werden. Nachdem sich Letzteres überraschend als zu teuer erwies und ein reines Luxushotel errichtet wurde, privatisierte der Investor im Handstreich auch noch den öffentlichen Schanzenpark, indem kein Zaun um das Hotel gezogen und die Polizei aufgefordert wurde, doch mal Ordnung im Park zu schaffen.
Das Hanseatische Oberlandesgericht erklärte jedoch mit Berufung auf ein Urteil des Reichsgerichts von 1884 (das lässt ein gewisses Missfallen vermuten), dass es ohne irgendeine Art von Zaun auch kein befriedetes Besitztum und damit keinen Hausfriedensbruch durch Hotelgegner*innen geben könne.[6] Öffentliche Parks als privaten Vorgarten zu nutzen, ist besonders dreist, aber auch nicht viel störender als verborgenere Formen der Privatisierung und Kommerzialisierung zu Gunsten von Privaten wie Tourismus-Boom und Eventisierung.
Der Ausverkauf von Städten an den Tourismus-Boom ist weltweit für urbane Zentren zu beobachten. Obwohl immer wieder als Garant von Aufschwung und Wirtschaftswachstum begrüßt, ist zugleich offensichtlich, dass Massentourismus, egal durch wen, sich signifikant negativ auf die Lebenssituation vor Ort auswirkt, insbesondere auf Höhe der Mieten, alltägliche Versorgung, soziale Infrastruktur und vieles mehr.[7]
Dennoch wird Tourismus quantitativ weiterhin als Richtschnur für den Wert und Erfolg einer Stadt propagiert. Nicht die Bedürfnisse derer, die in den Städten leben, sondern Verwertungslogiken stehen auch bei der urbanen Eventisierung im Mittelpunkt.[8] Unter dem Vorwand der Unterhaltung der Bevölkerung wird der öffentliche Raum durch Sportereignisse, Messen, Feste, Jahrmärkte usw. besetzt, was nicht nur die Infrastruktur erheblich belastet und die Mobilität behindert, sondern auch eine anderweitige Nutzung öffentlichen Stadtraums durch die Stadtgesellschaft ausschließt.
Viel interessanter könnten doch autofreie Wochenenden sein, welche den städtischen Straßenraum der selbstverantworteten kreativen Nutzung der Stadtgesellschaft überlassen. Stattdessen erfreut sich der Ausverkauf städtischen Raumes an Großereignisse der Sportwelt großer Beliebtheit, bei denen es weniger um viel beschworene Gemeinschaftserlebnisse geht als um exorbitante Summen für Sportfunktionäre, Sponsoren und einige wenige Profiteure, aber auch das Image der Stadt und einmal mehr den Tourismus.
Ein Nebeneffekt der Stadt als Marke sind nicht nur alltagsfremde Prioritäten und Disneyfizierung von Innenstädten, sondern auch konkrete architektonische Gestaltungsentscheidungen, welche autoritäre und rechtspopulistische Ideologien im Wortsinne „in Stein meißeln“ können. Insbesondere die zunehmend beliebten „Rekonstruktionen“ deutscher Alt- und Innenstädte wie in Frankfurt (Main) spiegeln eine bedenkliche Entwicklung.
Diese großen Prestigeprojekte kommunaler Politik können nicht Wohnraumprobleme lösen, plurale Nutzbarkeit garantieren und urbane Heimat für Alle schaffen, sondern höchstens der Sehnsucht nach den (ohnehin so nie existierenden) 1950ern, deutscher Größe und Gemütlichkeit Ausdruck verleihen. „Die Rekonstruktionsarchitektur entwickelt sich in Deutschland derzeit zu einem Schlüsselmedium der autoritären, völkischen, geschichtsrevisionistischen Rechten.“[9] Und sie prägt die Zentren unserer Städte auf Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte.
Dabei ist Geschichtsrevisionismus nicht unbedingt das zentrale Motiv der kommunalen Akteur*innen, aber der Wunsch nach einem sauberen Altstadtidyll, die Hoffnung auf mehr Tourist*innen und mangelnde Auseinandersetzung mit bspw. barrierefreier Stadtplanung (Design für alle) geben Geschichtsrevisionismus reichlich Raum.
Wenig Raum haben in der vermarkteten Stadt dagegen gesellschaftliche Randgruppen. Während Angehörige privilegierter Gruppen oder der Mehrheitsgesellschaft jedenfalls als Konsument*innen oder als Dienstleister*innen geduldet werden, erscheinen soziale Randgruppen in der Stadt des Tourismus, des Konsums, der Märkte und des kommerzialisierten Sports wie in idyllischen neuen Altstädten als störende Fremdkörper, welche den Wert der Stadt mindern. (↑ nach oben)
Armut bekämpfen oder arme Menschen verdrängen?
Wenig überraschend sind parallel zur Vermarktung der Stadt wieder vermehrte Bemühungen zur Verdrängung sozialer Randgruppen aus attraktiven städtischen Räumen zu beobachten. Hintergrund sind zum einen sogenannte Gentrifizierungsprozesse, also die Aufwertung und Verteuerung von Stadtvierteln und die damit verbundene Verdrängung bisheriger Bewohner*innen.[10]
Diese Prozesse geschehen allerdings auch nicht von selbst, sondern sind auf jahrelange staatliche Untätigkeit im sozialen Wohnungsbau, in der Stadtplanung, in der Umsetzung des Grundsatzes „Eigentum verpflichtet“ zurückzuführen. Zum anderen erfolgt die aktive Verwertung der Stadt als Marke, weshalb Armut in den Stadtteilen, in denen Tourist*innen oder betuchte Einwohner*innen flanieren wollen, empfindlich stört.
Im Umgang mit Armut und armen Menschen im städtischen Raum sind verschiedene soziale städtische Politiken denkbar, doch praktisch setzen sich häufig Politiken der Verdrängung durch. Dies ist erkennbar an den Diskussionen um rechtliche Bettelverbote. Zwar kann rechtmäßig nur sogenanntes aggressives, also nötigendes, Betteln (im Gegensatz zum erlaubten „stillen“ Betteln) verboten werden.[11]
Doch wird immer wieder versucht, weitergehende Bettelverbote auszusprechen. Hierzu dient insbesondere der Verweis auf organisiertes Betteln oder anwesende Kinder.[12] Letztere wären meist auch lieber in der Schule oder Kindertagesstätte, was ihnen jedoch oft verwehrt bleibt. Hintergrund ist zum einen, dass das Recht auf Bildung in Deutschland wenig anerkannt wird – so ist es nicht in der Verfassung verankert – und ein einfachgesetzliches Recht auf Schulbesuch an formalen Hürden wie der fehlenden Postadresse der Eltern oder drohenden Meldepflichten der Schule an Ausländerbehörden oder Jugendamt scheitert.
Dieser externe Inhalt erfordert Ihre Zustimmung. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.
Open external content on original siteBettelverbote lösen diese Probleme ebenso wenig wie sie den Menschen helfen, die in organisierten Strukturen zum Betteln gezwungen werden, sie machen sie lediglich unsichtbarer.[13] Politiken der Verdrängung armer Menschen äußern sich auch an der menschenfeindlichen Gestaltung öffentlicher Räume, damit längeres Verweilen unterbleibt: Rasen werden nachts besprengt, Bänke sind nicht zum Liegen da, Bushaltestellen haben praktisch kein Dach, Parks werden abends geschlossen und so weiter.
Politiken der Armutsbekämpfung als Alternative zu Politiken der Verdrängung armer Menschen sind weniger spektakulär, aufwändiger und kostenintensiver. Doch sie unterbleiben nicht nur aus finanziellen Gründen (obwohl die teils drastisch verschlechterte Finanzsituation von Städten einen nicht zu unterschätzenden Hintergrund für stadtpolitische Entwicklungen bildet[14]).
Längst hat sich ein Sicherheitsdiskurs etabliert, in dem der Begriff der Sicherheit als staatliche Aufgabe nicht etwa soziale Sicherheit (oder, für städtischen Raum auch interessant, Verkehrssicherheit) meint, sondern Sicherheit vor internationalem Terrorismus und Kriminalität, aber auch vor Gefühlen der Unsicherheit, wie sie aus der Konfrontation mit Armut und Fremdheit erwachsen können.[15] So wird in Sicherheitspolitiken in diesem engen Sinne investiert, also die Videoüberwachung öffentlicher Räume, Polizeiverordnungen und ihre Durchsetzung, die Aufrüstung der Polizei, der Einsatz privater Sicherheitsdienstleister etc., während zugleich die Bekämpfung von Armut in wesentlichem Ausmaß an die Zivilgesellschaft delegiert wird.
Armutsbekämpfung ist aber eine zwingende staatliche Aufgabe, die gar wichtiger sein könnte als Videoüberwachung. Es geht dabei nicht nur darum, dass wir vom modernen Sozialstaat einer reichen Industrienation sicherlich mehr erwarten dürfen, sondern auch um bedenkliche Verschiebungen. So zieht sich der Staat auf repressive Sicherheitspolitiken zurück, die in der beschriebenen Enge des Sicherheitsverständnisses ein bekanntes Merkmal autoritärer Entwicklungen sind.
Der öffentliche Raum sollte in einer demokratischen Gesellschaft ein selbst organisierter, pluraler Raum der Stadtgesellschaft sein, für dessen Gelingen der Staat die Mindestbedingungen garantiert. Stattdessen verfügt der Staat über den öffentlichen Raum, entzieht ihn damit demokratischen Aushandlungsprozessen und mutet den Bewohner*innen wahlweise im Namen der „Sicherheit“ oder der „Attraktivität“ der Stadt erhebliche Grundrechtseingriffe zu.
Solche Politiken nehmen die Bewohner*innen nur als gefährliche Subjekte oder als passive Konsument*innen wahr, nicht als Bürger*innen im Sinne aktiver citizenship (Bürgerschaft) und Gestaltung des städtischen Lebensraumes. Dabei gerät staatliches Handeln immer mehr zum Selbstzweck, was als autoritäre Entwicklung zu kritisieren ist. Auch die rücksichtslose Vermarktung und Verwertung städtischen Raumes ist eine Politik autoritärer Entscheidungen über die Verteilung von öffentlichen Ressourcen, welche die Bedürfnisse der Stadtgesellschaft in ihrer Pluralität ignoriert.
Große Sportereignisse, Messen und Märkte nehmen erhebliche Teile begehrten öffentlichen Raumes ein, der nicht mehr für andere Nutzungen zur Verfügung steht. Die Verwaltung des Mangels wird dagegen der Zivilgesellschaft überlassen, welche aber weder an soziale Rechte noch an Diskriminierungsverbote gebunden ist, weshalb sich hier auch Spielwiesen für nicht-staatliche autoritäre und rechtspopulistische Politiken eröffnen. Es gibt freiwillige Helfer*innen und Spender*innen, die darauf bestehen, nur Wohnungslose mit deutscher Staatsbürgerschaft zu unterstützen, oder es wird massiv versucht, Unterstützung für Geflüchtete und für Wohnungslose gegeneinander auszuspielen.[16] Die Teilhabe am öffentlichen Raum, soziale Rechte und das Recht auf Stadt[17] gelten aber für alle Bewohner*innen und müssen für sie alle zur Geltung gebracht werden. (↑ nach oben)
Videoüberwachung statt sichere Radwege
Der derzeit allgegenwärtige, dysfunktional enge Sicherheitsbegriff hat auch an anderer Stelle ungünstige Auswirkungen. So sterben in Deutschland ungleich mehr Menschen bei tödlichen Verkehrsunfällen als durch terroristische Anschläge, nicht wenige davon sind Radfahrer*innen oder Fußgänger*innen in deutschen Großstädten und die meisten Unfälle sind vermeidbar.
Für Menschen, die nicht mit dem Auto unterwegs sind, wäre ein echter Beitrag zu ihrer persönlichen Sicherheit (ganz basal als Schutz von Leib und Leben) die autofreie Stadt oder doch wenigstens Verkehrskonzepte und eine Infrastruktur für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen, die ihren Bedürfnissen Rechnung trägt und ihrer Unversehrtheit Vorrang gibt vor dem in Deutschland tief gefühlten Recht aufs Autofahren, welches allerdings nicht im Grundgesetz steht.
Wie oben dargestellt, wird Sicherheit in der Stadt aber auf Schutz vor Kriminalität und Terrorismus reduziert. Und ein gepriesenes Mittel ist die Videoüberwachung, welche die (oftmals gerade gesuchte) Anonymität der Großstadt aufhebt und zu Verdrängung und Verhaltensänderungen (chilling effects) führen kann.[18] Verschiedene Pilotprojekte zur Videoüberwachung in Deutschland bilden den technischen Fortschritt ab, mit dem der Datenschutz kaum noch Schritt hält.[19]
Kritik wird regelmäßig entgegengehalten, dass schon einmal ein Verbrechen mit Hilfe von Videoüberwachung aufgeklärt wurde, vor allem aber, dass unbescholtene Bürger*innen durch solche Maßnahmen doch nichts zu befürchten hätten und daher nicht beeinträchtigt werden könnten. Längst findet eine permanente Kontrolle öffentlicher Plätze und des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs statt.
Die Polizei in Hamburg will Software zur Gesichtserkennung, welche bisher zur Strafverfolgung im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel genutzt wurde, künftig dauerhaft und flächendeckend einsetzen, ohne die verfassungsrechtlichen Bedenken des Hamburger Datenschutzbeauftragten ernsthaft zu prüfen.[20] Mit dieser Software können biometrische Gesichtsabdrücke erstellt, Personen auf Videomaterial erkannt sowie Standortdaten, Verhaltensprofile und soziale Kontakte rekonstruiert werden. Die Software ist zum Vergleich auf große Datenmengen angewiesen und lädt zum unbegrenzten Sammeln personenbezogener Daten sowie dem Aufbau immenser Datenbanken ein. Biometrische Massenerhebungen und gläserne Bürger*innen werden damit Realität. Zugleich werden erhebliche Ressourcen gebunden, die in Aufbau und Garantie sozialer Sicherheit investiert werden könnten. (↑ nach oben)
Racial Profiling statt weibliche Teilhabe
Der Sicherheitsbegriff in städtischen Politiken des öffentlichen Raumes blendet die soziale Dimension und die Bedeutung von Infrastruktur und Verkehrskonzepten für die Sicherheit der Stadtbewohner*innen aus und beschränkt sich auf repressive Sicherheitspolitiken der Überwachung und Verdrängung. Zugleich wird dieser autoritäre Sicherheitsbegriff rassistisch aufgeladen. Seit „Köln“ als Chiffre dafür steht, dass die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen im öffentlichen Raum durch Gruppen von jungen männlichen Migranten aus nordafrikanischen Staaten bedroht sei, können sich auch Parteien des rechten Spektrums für „Frauenrechte“ erwärmen. Die Frage der Teilhabe am öffentlichen Raum wird zum Vorteil weißer Männer geschlechtsspezifisch und rassistisch strukturiert.
Durch den Mythos von „den Fremden“, die im öffentlichen Raum „unsere Frauen“ bedrohen, werden wesentliche Fragen von Verteilung und Nutzung des öffentlichen Raumes als Ressource aktiv ausgeblendet.[21] Die Frage der Teilhabe von Frauen am öffentlichen Raum, welche seit der Trennung von öffentlicher und privater Sphäre durchaus nicht selbstverständlich ist, ist kein Thema mehr. Gleiches gilt für den Befund, dass die Würde, körperliche Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung von Frauen primär in ihrer eigenen Wohnung oder der ihres (Ex-)Partners bedroht sind, nicht in der Öffentlichkeit.
Die von der Forschung lange als irrational abgewerteten Gefühle von weiblicher Unsicherheit in der Öffentlichkeit sind handfeste Mittel der Herrschaft im öffentlichen Raum.[22] Dies zeigen auch die Diskurse „nach Köln“ – so muss die weiße Frau nun den Schutz eines biodeutschen Mannes, bspw. des Partners, in Anspruch nehmen, will sie gefahrlos den öffentlichen Raum betreten. Nach den massiven Gewalterfahrungen und der Belästigung und Ausgrenzung von Women of Colour oder LGBTIQ-Personen im öffentlichen Raum[23] fragt dagegen niemand und Schutz wird auch nicht angeboten.
Doch werden nicht nur Betroffene und ihre Bedürfnisse ignoriert. Zugleich wird die Frage der Teilhabe am öffentlichen Raum als Sicherheitsfrage konzipiert, welche durch repressive (und nicht selten rechtswidrige) Sicherheitspolitiken gelöst werden könne. Als Tätergruppe werden „fremde“ junge Männer festgelegt, die ohnehin im Fadenkreuz von Verwertungslogiken und Sicherheitsfantasien im öffentlichen Raum stehen. Mit der Behauptung, weibliche Teilhabe am öffentlichen Raum sichern zu wollen, kann nun gegen sie vorgegangen werden.
Wer konsumieren kann, darf bleiben.
Dies erfolgt insbesondere durch Maßnahmen des „Racial Profiling“, also durch verdachtsunabhängige Polizeikontrollen, die sich weit überdurchschnittlich gegen Menschen richten, welche von rassistischer Diskriminierung betroffen sind.[24] Da die Hautfarbe schlechterdings nicht der Anknüpfungspunkt für anlassunabhängige Kontrollen sein darf, werden diese teils mit statistisch unhaltbaren Behauptungen, teils schlicht mit Bezügen zu „Köln“ begründet – und treffen natürlich auch Women of Color, also Frauen. Diskriminierung und Teilhabeausschluss werden nicht verringert, sondern durch rassistische und sexistische Politiken neu erzählt, partiell verschoben und faktisch verstärkt. (↑ nach oben)
Autoritäre Sicherheitsdiskurse und neoliberaler Ausverkauf
Es ist kein Zufall, dass junge Männer mit Erfahrungen rassistischer Diskriminierung als Gegenstand von Sicherheitspolitiken entdeckt werden, welche sie aus städtischen öffentlichen Räumen verdrängen sollen.[25] Vielmehr zeigt sich auch hier die enge Verbindung autoritärer Sicherheitsdiskurse und eines neoliberalen Ausverkaufs öffentlicher städtischer Räume. Kurz gesagt: Wer konsumieren kann, darf bleiben. Staatliche Sicherheitspolitiken sollen nicht nur Sozialpolitik, Verkehrspolitik, gerechte und soziale Stadtplanung oder Infrastrukturpolitik (zumindest in Teilen) ersetzen, sondern dienen nicht selten offen der Absicherung von Kommerzialisierung, Privatisierung und Konsum.
Kommerzialisierung und Privatisierung in verschiedensten Formen (bspw. ständige Belegung öffentlichen Raumes durch Sport-Events) verknappen die ohnehin sehr begrenzte Ressource des öffentlichen Raumes noch weiter und verschärfen Konflikte, die dann durch repressive Sicherheitspolitiken scheinbar gelöst werden können. Gerade privilegierte Nutzer*innen städtischen Raumes fühlen sich bedroht und verlangen nach öffentlicher Sicherheit.
Zugleich sind Sicherheitspolitiken nicht erst seit „Köln“ auch von rassistischen Vorurteilen bestimmt und davon beeinflusst, welche Personengruppen Schutz „verdienen“. So dürfen besoffene Touristen sich vielfach in einer Weise benehmen, die bei Obdachlosen oder jungen männlichen Migranten oder von rassistischer Diskriminierung Betroffenen sofort die Polizei auf den Plan rufen würde. Wer im Restaurant ein Bier trinkt, genießt seine Freizeit, wer eine mitgebrachte Flasche Bier auf der Parkbank oder an der Bushaltestelle konsumiert, ist verdächtig und eine Gefahrenquelle.[26]
Geschlechterstereotype, rassistische Vorurteile und ökonomischer Status strukturieren und determinieren Teilhabe am öffentlichen Raum. Zugleich sind weder autoritäre Sicherheitsdiskurse noch neoliberaler Ausverkauf ein ernsthaftes Politikangebot an die städtische Zivilgesellschaft. Diese muss sich ihre Stadt friedlich zurückerobern, lebenswerte Räume einfordern, bezahlbaren Wohnraum, öffentliche Räume ohne Konsumpflicht, in denen man sich aufhalten möchte, sichere Verkehrskonzepte, Multifunktionalität und Barrierefreiheit, kurz: den städtischen Raum, in dem sich eine Zivilgesellschaft als Gemeinschaft organisieren kann. (↑ nach oben)
Bürger*innen als Akteur*innen, als Gesprächspartner*innen oder als Gefahr?
Das gute Leben in der Stadt kann nicht einfach vom Staat kommen, auch wenn dieser für einige Grundbedingungen zwingend in der Verantwortung ist, sondern es braucht gerade bzw. besteht gerade in der städtischen Bürger*innengesellschaft, wobei als Bürger*innen in diesem Sinne alle Bewohner*innen zu verstehen sind, unabhängig von ihrem formalen rechtlichen Status (citizenship). Allerdings zielen städtische Politiken oftmals nicht auf Selbstorganisation, sondern wollen es bei vollmundig angekündigten Bürgerbeteiligungen belassen, die sich punktuell zu städtischen Politiken äußern dürfen.
Diese Beteiligungsverfahren führen oft nur zu großer Frustration, weil die Verfahren gar nicht halten können, was sie versprechen, oder die Bürger*innen nur alibimäßig beteiligt werden, aber auch, weil es wenig klare Auseinandersetzung darüber gibt, wer an welchen Entscheidungen beteiligt werden soll.[27] Ohnehin wird von staatlicher Seite regelmäßig unterstellt, dass die Bürger*innen bzw. Bewohner*innen nicht das Gemeinwohl im Auge haben, sondern nur ihre partikularen Interessen. Und in der Tat ist sehr genau zu schauen, wer da eigentlich spricht und gehört wird und wer nicht, denn auch das ist ohne innovative Verfahrensformen fast vollständig abhängig von ökonomischem Status, Bildungsniveau, Geschlecht und rassistischen Zuschreibungen. Solche Barrieren durch Diskriminierung können aber überwunden werden, wenn der politische Wille hierzu besteht.
Rechtlich sind bestimmte Beteiligungsverfahren in der Stadtplanung vorgesehen, deren Orientierung auf Gesetzmäßigkeitsprüfungen, mangelnde Transparenz, später Einsatz, enge Personenauswahl und starrer Rahmen ohne Verhandlungsspielraum sie oft als wenig geeignet für partizipatorische Planungs- und Entwicklungsprozesse erscheinen lässt.[28] Vielversprechender erscheinen innovative Beteiligungsformen wie Zukunfts- oder Perspektivenwerkstätten, runde Tische, Planspiele, Konsensusgipfel, Fokusgruppen, digitale Alternativplanung und weitere.[29]
Die Beispiele für gelingende wie nicht gelungene Beteiligungsformen sind inzwischen vielfältig. So hat die durchaus umfassende Bürgerbeteiligung an den fortdauernden Protesten gegen Stuttgart21 nichts geändert. In Hamburg wurde recht erfolgreich mit partizipatorischen digitalen Beteiligungsmöglichkeiten gearbeitet,[30] wobei untersucht werden müsste, wer daran teilnimmt und wer eben nicht. Für Berlin werden ebenfalls positive Beispiele partizipatorischer Stadtplanung genannt wie das Wriezener Freiraumlabor, der Prinzessinnengarten und die Tempelhofer Freiheit.[31] Der Volksentscheid von 2014, bei dem knapp 740.000 Berliner*innen sich gegen jegliche Bebauung des Feldes entschieden, steht jedoch gerade wieder zur Diskussion, was nicht unerhebliche Frustration hervorruft.[32]
Allerdings werden jenseits von formalen Beteiligungen der bürgerlichen Mittelschicht die Bewohner*innen häufig nicht nur als eigensinnige Akteur*innen oder gleichberechtigte Gesprächspartner*innen abgelehnt, sondern als reines Gefahrenpotential angesehen, vor allem, wenn sie öffentlichen Raum anders nutzen wollen als behördlich vorgesehen. Das kann sich an konkreten Konflikten festmachen – wie dem Streit um bezahlbaren Wohnraum –, aber auch auf einer grundsätzlich autoritären Perspektive beruhen, welche nicht auf Kommunikation mit der Stadtgesellschaft, sondern Beherrschung des Stadtraumes abzielt. Die Stadt wird aus dieser Sicht zum Ort polizeilicher Planspiele, zur Herausforderung für Polizeitaktiken und Crowd Control (Kontrolle von großen Menschenmengen), aufgeteilt in gute Gegenden und in Gefahrengebiete, in denen der Staat weitgehend entgrenzt agiert.[33] (↑ nach oben)
Bürgerkriegsspiele statt politische Auseinandersetzungen
Die autoritäre Entscheidung über Privatisierung und Eventisierung lässt städtischen öffentlichen Raum als existentielle Ressource und Gemeingut verschwinden. Sie orientiert sich zudem nicht am städtischen Gemeinwohl, sondern an sachfremden Indikatoren wie Tourismuszahlen oder den Gewinnerwartungen privater Unternehmen.
Autoritäre Sicherheitspolitiken schaffen weder soziale Sicherheit noch Verkehrssicherheit, sondern verschärfen Diskriminierung und Ausgrenzung von der Teilhabe am öffentlichen Raum. Für die Mehrheit der Stadtgemeinschaft wirken sich autoritäre Stadtpolitiken daher negativ auf ihre Lebensqualität, Sicherheit und Teilhabe aus. Sie sind durch soziale, inklusive, auf Teilhabe und Nicht-Diskriminierung gerichtete, partizipative Politiken abzulösen, wie dies auch vielerorts immer wieder versucht wird und geschieht.
Allerdings ist durch autoritäre Privatisierungs- und Sicherheitspolitiken auch der städtische Raum als politischer bedroht. Die Stadt ist nicht nur Lebensraum, sondern auch politischer Raum, und Menschen leben auch in Städten, weil sie politisch aktiv und wirksam sein wollen.[34] In Theorien zum öffentlichen Raum ist meist schwärmerisch von der Agora die Rede, von städtischem Raum, der als Marktplatz der Stadtgesellschaft dem politischen Meinungsaustausch dient. Tatsächlich findet inzwischen eine Vielzahl von politischen Versammlungen in deutschen Großstädten statt. Zugleich gibt es auch ein sehr restriktives bzw. repressives Versammlungsrecht sowie faktische Polizeieinsätze, welche die Versammlungsfreiheit konterkarieren.
Soziale und politische Proteste werden kriminalisiert, statt die politische Auseinandersetzung zu suchen. Ein exemplarisches Beispiel sind die Aktionstage des Blockupy-Bündnisses in Frankfurt/Main, welche im Vorfeld als bürgerkriegsähnliche Zustände antizipiert und verboten wurden, während tatsächlich die meisten Störungen von einem unverhältnismäßigen Polizeiaufgebot und unverhältnismäßigen Polizeimaßnahmen ausgingen.[35] Auch bei den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg legten sich Innensenator und Polizei früh darauf fest, dass von den protestierenden grundsätzlich Gewalt ausgehe, der reibungslose Ablauf des Gipfels höchste Priorität habe und daher eine Strategie der Härte statt der Deeskalation anzuwenden sei.[36] Die Eskalation der Gewalt als eine Folge dieser Entscheidungen ist bekannt.
Inzwischen entsteht bei politischen Protesten manchmal der Eindruck, dass der städtische Raum genutzt wird, um einmal neue Polizeitaktiken der Aufstandsbekämpfung zu erproben. Auch ist militarisierte Polizei selbst bei zahlenmäßig kleineren Versammlungen inzwischen nichts Außergewöhnliches mehr und wird nach jeder Demonstration von interessierten Kreisen (exemplarisch genannt sei hier Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft) lauthals eine weitere Militarisierung der Polizei nach amerikanischem Vorbild gefordert.[37]
Das Versammlungsrecht ist seit der Föderalismus-Reform Ländersache, so dass die Teilnahme an Versammlungen jenseits der eigenen Landesgrenzen schon fortgeschrittene juristische Kenntnisse voraussetzt. Bisher haben fünf Bundesländer von der neuen Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht und eigene Landesversammlungsgesetze erlassen.
Dabei wurde teils versucht, der Versammlungsfreiheit mehr praktische Wirksamkeit und Bedeutung zu verleihen, so in Schleswig-Holstein, wo das Gesetz nicht zufällig den Titel „Versammlungsfreiheitsgesetz“ trägt. In anderen Bundesländer wurde dagegen die repressive Seite des Versammlungsrechts betont und insbesondere die Chance zur Entkriminalisierung kaum genutzt. Vielmehr blieb die höchst problematische Strafbarkeit von Verstößen gegen das sogenannte Vermummungsverbot und das sogenannte Schutzwaffenverbot[38] nicht nur in allen Bundesländern bestehen, in denen das alte Versammlungsgesetz des Bundes weitergilt, sondern auch in einigen der Länder mit Neuregelungen. Die ursprünglich-ungebändigte unmittelbare Demokratie auf der Straße stellt eine Herausforderung dar, auf die nicht selten mit autoritärer Repression und Abschreckung geantwortet wird.
Dabei erschöpfen sich zivilgesellschaftliche Stadtpolitiken natürlich nicht in Versammlungen, diese sind vermutlich nicht einmal eine paradigmatische Aktionsform. Aber wie die Bereitschaft zur ungebremsten Kommerzialisierung und die Reduzierung auf autoritär-repressive Sicherheitspolitiken zeigt auch der Umgang mit Versammlungen grundsätzlich problematische Politikverständnisse an. (↑ nach oben)
Öffentlicher Raum als Staatsaufgabe – Öffentlichkeit als Raum der Zivilgesellschaft
Autoritäre Politiken setzen auf Sicherheit und Ordnung in einem sehr engen Verständnis einer sauberen und marktkompatiblen Stadt und geben im Übrigen neoliberaler Verwertung Raum oder unterstützen diese aktiv. Paradigmen von Sicherheit und Konsum müssen abgelöst werden durch zivilgesellschaftliche Selbstverwaltung und durch soziale und infrastrukturelle Politiken, welche diese ermöglichen. Der Staat hat jedenfalls dafür Sorge zu tragen, dass die Bewohner*innen der Stadt und ihre Gäste den städtischen öffentlichen Raum nutzen können: ohne Diskriminierung oder Belästigung, als Lebensraum, für ihren Lebensunterhalt oder als politische Bühne, selbstbestimmt und frei und kollektiv.
Insofern ist der öffentliche Raum Staatsaufgabe (und nicht staatliche Verfügungsmasse oder primärer Herrschaftsort, um dies nochmals zu betonen). Daher sollte sich der Staat engagieren, soweit die Grundvoraussetzungen zu schaffen sind, aber die konkrete Nutzung auch zivilgesellschaftlichen Aushandlungsprozessen überlassen. Staatlicherseits ist vor allem zu garantieren, dass plurale diskriminierungsfreie Nutzungen städtischen Raumes möglich sind und weder durch Diskriminierung noch Ausgrenzung noch menschenfeindliche Gestaltung noch nur sich selbst bestätigende Sicherheitspolitiken behindert werden.
Autoritäre Politiken leben von Angst und schüren Angst,[39] sie setzen auf Ausgrenzung und sie vollziehen Ausgrenzung, sie machen eine streitlustige Stadtgesellschaft zu einer konsumierenden oder sich (vor dem Terrorismus, der Polizei, den privaten Sicherheitsdiensten) versteckenden Masse. Gesellschaft findet aber statt in Auseinandersetzung, in Aushandlungsprozessen, in gemeinsamer Gestaltung und für all dies muss die Stadt ein Ort sein. (↑ nach oben)
[1] Tagesspiegel vom 23.07.2018, https://www.tagesspiegel.de/berlin/angriff-auf-obdachlose-am-bahnhof-schoeneweide-als-gesellschaft-haben-wir-die-pflicht-diese-menschen-nicht-haengen-zu-lassen/22835550.html.
[2] Siehe nur Berliner Zeitung vom 01.08.2018, https://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/brandanschlag-auf-obdachlose--tatverdaechtiger-handelte-offenbar-aus-wut-31046246.
[3] Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Zahlen zur Gewalt gegen wohnungslose Menschen, 2018, http://www.bagw.de/de/themen/gewalt/statistik_gewalt.html.
[4] Dazu Belinda Davis, Polizei und Gewalt auf der Straße. Konfliktmuster und ihre Folgen im Berlin des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Lüdtke et al. (Hg.), Polizei, Gewalt und Staat im 20. Jahrhundert, 2011, S. 81-103.
[5] Grundlegend Angelika Siehr, Das Recht am öffentlichen Raum. Theorie des öffentlichen Raumes und die räumliche Dimension von Freiheit, 2016.
[6] Siehe hierzu Magda Schneider, Mövenpick ist nicht befriedet, in: taz vom 24.02.2010, http://www.taz.de/!5147007/.
[7] Statt vieler Erik Peter, Die disneyfizierte Hölle verhindern, in: taz vom 14.08.2018, https://www.taz.de/!5524809/.
[8] Vgl. Ronald Hitzler, Eventisierung, 2011, S. 45ff.
[9] Hierzu am Beispiel der neuen Frankfurter Altstadt Stephan Trüby, Wir haben das Haus am rechten Fleck, in: FAZ vom 16.04.2018, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/neue-frankfurter-altstadt-durch-rechtsradikalen-initiiert-15531133.html. Einen ganz anderen Blick auf die neue Frankfurter Altstadt hat Hanno Rauterberg, Altstadt für alle!, in: ZeitOnline vom 16.05.2018, https://www.zeit.de/2018/21/frankfurt-altstadt-rekonstruktion-rechtspopulismus-revisionismus/komplettansicht.
[10] Eine knappe Erläuterung zu Gentrifizierung findet sich bspw. hier: https://difu.de/publikationen/difu-berichte-42011/was-ist-eigentlich-gentrifizierung.html. Zum Zusammenhang von Gentrifizierung, Racial Profiling und rassistischer Polizeigewalt siehe auch Nora Keller, Wer hat Angst vorm Kottbusser Tor? Zur Konstruktion „gefährlicher“ Orte, CILIP 2018, https://www.cilip.de/2018/04/27/wer-hat-angst-vorm-kottbusser-tor-zur-konstruktion-gefaehrlicher-orte/.
[11] Der österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat explizit dargelegt, dass ein Totalverbot, welches auch das „stille“ Betteln erfasst, wegen Verstoßes gegen den Gleichheitssatz und die Meinungsfreiheit verfassungswidrig ist, siehe Erkenntnis vom 28.06.2017, V 27/2017-14. [Interessanterweise wäre ein örtlich und zeitlich begrenztes Verbot aber erlaubt, wenn es eine vorrangige Nutzung des öffentlichen Ortes gibt wie bspw. einen Christkindelmarkt, siehe VfGH, Erkenntnis vom 14.10.2016, E 552/2016 u.a., und vom 14.03.2017, V 23/2016.] Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat noch nicht über Bettelverbote entschieden, aber in anderem Zusammenhang ausgeführt: „Ein vom Elend der Welt unbeschwertes Gemüt des Bürgers ist kein Belang, zu dessen Schutz der Staat Grundrechtspositionen einschränken darf.“ (BVerfG vom 12.12.2000, 1 BvR 1762/95, 1787/95). Im juristischen Diskurs und der Rechtspraxis besteht Einigkeit, dass sog. „stilles“ Betteln nicht verboten werden kann und die Polizei auch nicht dagegen einschreiten darf, siehe nur Friedrich Schoch, Behördliche Untersagung „unerwünschten Verhaltens“ im öffentlichen Raum, in: Jura 11/2012, S. 858 (863f, mwN). Dies hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH BW) bereits mit Beschluss vom 06.07.1998, Az. 1 S 2630/97, entschieden und das allgemeine Bettelverbot in einer Polizeiverordnung für nichtig erklärt.
[12] So gilt seit Dezember 2015 in Berlin eine Rechtsverordnung, welche das Betteln von Kindern oder in Begleitung von Kindern (unter vierzehn Jahren) als Ordnungswidrigkeit mit Geldbußen von bis zu 500 Euro bedroht. Kritisch hierzu Werner Knake, Armut unter Strafe, in: berliner straßenmagazin motz 10/15, S. 4-5. Eine Ermächtigungsgrundlage für vergleichbare Verbote gibt es auch in Bremen.
[13] Zur kritischen Auseinandersetzung mit Bettelverboten und Alternativen hierzu siehe die Beiträge in: berliner straßenmagazin motz 10/15, S. 4-9.
[14] Hierzu Peter Bescherer/Rita Haverkamp/Tim Lukas, Das Recht auf Stadt zwischen kommunaler Sparpolitik und privaten Investitionen, in: Kritische Justiz 2016, S. 72-85.
[15] Grundlegend Tobias Singelnstein/Peer Stolle, Die Sicherheitsgesellschaft. Soziale Kontrolle im 21. Jahrhundert, 3. Aufl. 2012.
[16] Siehe hierzu Judith Colling, Deutsche, die nur Deutschen helfen, in: ZeitOnline vom 14.03.2016, https://www.zeit.de/wirtschaft/2016-03/rechtspopulismus-berlin-obdachlose-obdachlosenhilfe-buergerinitiativen/komplettansicht.
[17] Vgl. zum Recht auf Stadt Andrej Holm, Das Recht auf die Stadt, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 2011, https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2011/august/das-recht-auf-die…
[18] Hierzu Robert Weinhold/Philipp Richter/Marco Krüger/Katrin Geske, Von Kameras und Verdrängung. Rechtliche Anknüpfungspunkte für ein Recht auf Stadt unter besonderer Diskussion der Videoüberwachung öffentlicher Räume, in: Kritische Justiz 2016, S. 31 (39ff).
[19] Zur Diskrepanz von technischen Möglichkeiten und Datenschutz siehe auch Marie Bröckling, Netz unter Kontrolle im Dossier.
[20] Siehe Kai von Appen, Hamburger Polizei hat Datenhunger, in: taz vom 06.08.2018, http://www.taz.de/!5521113/; sowie Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Pressemitteilung und Prüfbericht vom 31.08.2018, https://datenschutz-hamburg.de/pressemitteilungen/2018/08/2018-09-31-polhh-g20-videmo360.
[21] Grundlegend Ulrike Lembke, Weibliche Verletzbarkeit, orientalisierter Sexismus und die Egalität des Konsums: Gender-race-class als verschränkte Herrschaftsstrukturen in öffentlichen Räumen, in: Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien (Hg.), Grenzziehungen von „öffentlich“ und „privat“ im neuen Blick auf die Geschlechterverhältnisse, Bulletin Texte 43 (2017), S. 30–57.
[22] Dazu Renate Ruhne, Raum Macht Geschlecht. Zur Soziologie eines Wirkungsgefüges am Beispiel von (Un)Sicherheiten im öffentlichen Raum, 2003.
[23] ‚Women of Color‘ bezeichnet weibliche Personen nicht-weißer Hautfarbe, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind; ‚LGBTIQ-Personen‘ sind lesbische, schwule, bisexuelle, Trans*, Inter* und queere Personen, welche nicht den herrschenden Geschlechter- und Sexualnormen entsprechen und daher häufig von Diskriminierung betroffen sind. Zur Gewaltbetroffenheit siehe LesMigraS/Maria do Mar Castro Varela et al., „… nicht so greifbar und doch real“. Eine quantitative und qualitative Studie zu Gewalt- und (Mehrfach) Diskriminierungserfahrungen von lesbischen, bisexuellen Frauen und Trans* in Deutschland, 2012; sowie European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Main results, 2014.
[24] Zur Rechtswidrigkeit solcher Kontrollen siehe nur Hendrik Cremer, Das Verbot rassistischer Diskriminierung nach Art. 3 Abs. 3 GG. Ein Handlungsfeld für die anwaltliche Praxis am Beispiel von „Racial Profiling“, in: AnwBl 2013, S. 896ff; Jeannine Drohla, Hautfarbe als Auswahlkriterium für verdachtsunabhängige Polizeikontrollen?, in: ZAR 2012, S. 411ff; Doris Liebscher, „Racial Profiling“ im Lichte des verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbots, in: NJW 2016, S. 2779ff; Alexander Tischbirek & Tim Wihl, Verfassungswidrigkeit des „Racial Profiling“, in: JZ 2013, S. 219ff.
[25] Zum institutionellen und strukturellen Rassismus solcher Raumpolitiken und Formen des Widerstands siehe Rea Jurcevic/Tarek Naguib/Tino Plümecke/Mohamed Wa Baile & Chris Young für die Schweizer Allianz gegen Racial Profiling, Racial Profiling und antirassistischer Widerstand als Raumpraxis, in: Aigner/Kumnig (Hg.), Stadt für Alle! Analysen und Aneignungen, 2018, S. 122-148.
[26] Zu Bettelverboten und Alkoholverboten statt vieler Wolfgang Hecker, Umstrittener öffentlicher Raum: zur neueren Rechtsentwicklung, CILIP 2018, https://www.cilip.de/2018/04/24/umstrittener-oeffentlicher-raum-zur-neueren-rechtsentwicklung/.
[27] Statt vieler Klaus Selle, Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung – Auf dem Weg zu einer kommunikativen Planungskultur?, in: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 1/2007, S. 63-71.
[28] Zugleich sehr kritisch zur sozialen Integrationskraft informeller Beteiligung unter dem Paradigma der Vermarktlichung: Kai Dröge/Chantal Magnin, Integration durch Partizipation? Zum Verhältnis von formeller und informeller Bürgerbeteiligung am Beispiel der Stadtplanung, in: Zeitschrift für Rechtssoziologie 31 (2010), S. 103-121.
[29] Einige Beispiele werden dargestellt und bewertet von Kati Storl, Bürgerbeteiligung in kommunalen Zusammenhängen. Ausgewählte Instrumente und deren Wirkung im Land Brandenburg, 2009, http://pub.ub.uni-potsdam.de/volltexte/2009/3594/.
[30] Hierzu Maren Lübcke/Rolf Lührs/Dorothée Rütschle, Die Zukunft der Stadtentwicklung: online und partizipativ?, in: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 10/2011, S. 627-636.
[31] Beispiele und Einordnung von Riklef Rambow & Nicola Moczek, Partizipative Stadt- und Raumgestaltung, 2012, http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/kulturelle-bildung/137868/partizipative-stadt-und-raumgestaltung.
[32] Siehe nur Lorenz Maroldt, in: Der Tagesspiegel vom 14.10.2018, https://www.tagesspiegel.de/berlin/noch-ein-volksentscheid-lasst-die-finger-vom-tempelhofer-feld/23177464.html. Dem an sich zutreffenden Argument des massiven Mangels an bezahlbarem Wohnraum seitens der Politik ist natürlich kaum etwas entgegen zu halten außer vielleicht dem Hinweis, dass auch die meisten Nutzer*innen der Tempelhofer Freiheit sich seit Jahren eine wirksame Politik gegen Gentrifizierung, Verteuerung, Spekulationen mit Wohnraum und Verdrängung wünschen.
[33] So Moritz Assall/Carsten Gericke, Zur Einhegung der Polizei. Rechtliche Interventionen gegen entgrenzte Kontrollpraktiken im öffentlichen Raum am Beispiel der Hamburger Gefahrengebiete, in: Kritische Justiz 2016, S. 61-71.
[34] Zur Stadt als idealem Ort für öffentliches politisches Handeln Houssam Hamade, Rehe stinken, in: taz vom 28.05.2018, http://www.taz.de/!5505815/.
[35] Statt vieler Bernd Belina, Versicherheitlichte Städte: Wer gehört zur Stadt?, CILIP 2018, https://www.cilip.de/2018/04/16/versicherheitlichte-staedte-wer-gehoert-zur-stadt/#respond; Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V., Blockupy: Demonstrationsbeobachtung am 18. März 2015, abrufbar unter www.grundrechtekomitee.de.
[36] Eskalation. Dynamiken der Gewalt im Kontext der G20-Proteste in Hamburg 2017. Forschungsbericht Berlin/Hamburg 2018. Abrufbar unter https://g20.protestinstitut.eu/.
[37] "Aber auch andere Perspektiven innerhalb der Polizei sind möglich: So werden von PolizeiGrün e.V. deutlich andere Ansichten zur Bedeutung von Demokratie und Rechtsstaat und den Möglichkeiten deeskalierender Polizeiarbeit vertreten (siehe https://polizei-gruen.blogspot.com); auch die Einschätzung der Ereignisse während des G20-Gipfels fällt erfreulich differenziert aus (siehe https://vionville.blogspot.com/2017/07/G20-Polizistensicht.html)."
[38] Das sog. Vermummungsverbot in § 17a VersammlG wird inzwischen so weit verstanden, dass schon das bloße Dabeihaben von Halstuch, Sonnenbrille und Basecap erhebliche Probleme hervorrufen kann, das sog. Schutzwaffenverbot aus § 17a VersammlG erfasst nach der Auffassung einiger Gerichte inzwischen alles, was gegen unverhältnismäßige Polizeieinsätze helfen könnte, so bspw. auch Frischhaltefolie, weil diese vielleicht gegen Tränengas schützt.
[39] Interessant ist beispielsweise, dass AfD-Wähler*innen die Sicherheitshysterie ihrer Partei („neue Messernormalität in Deutschland!“) offensichtlich auch verinnerlichen, denn sie haben signifikant mehr Angst vor Terrorattacken als Wähler*innen anderer Parteien und meiden konsequent öffentliche Plätze, siehe https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_83679648/umfrage-die-haelfte-der-afd-anhaenger-meidet-oeffentliche-plaetze.html.
Dieser Beitrag ist Teil unseres Dossiers "Politik im autoritären Sog". Sie können das vollständige Dossier hier als PDF herunterladen.